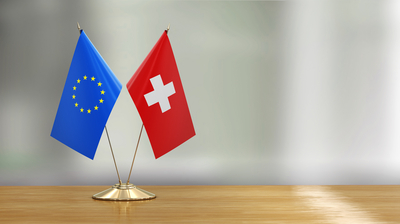Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird in der Schweiz heute unterschiedlich gefördert. Während v.a. für die Wasserkraft und kleine Photovoltaikanlagen (PV) einmalige Investitionsbeiträge ausbezahlt werden, erhalten Windkraft, Biogas, neue Kleinwasserkraft, grosse PV und Geothermie die Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) (Abbildung 1). Die KEV vergütet den Strom mit einer festen Entschädigung pro Kilowattstunde. Diese wird so festgelegt, dass der Anlagenbetreiber unter Berücksichtigung einer Eigenkapitalverzinsung seine Gestehungskosten etwa decken kann.
Um überhöhte Subventionen zu verhindern, wird die KEV für Neuanlagen über die Zeit abgesenkt, wenn die Technologie Fortschritte macht und günstiger wird. Mit steigendem Anteil Erneuerbarer gelangt das KEV-Modell jedoch an Grenzen: Einerseits lassen sich durch die administrative Festlegung der Entschädigungen die individuell unterschiedlichen Kosten verschiedener Anlagentypen nur beschränkt abbilden, gerade bei dynamischem technischen Fortschritt. Anderseits hat der Betreiber keinerlei Anreize, seine Anlage an den Bedürfnissen des Marktes – sprich an den Preisen – auszurichten.

KEV, Marktprämie oder Investitionsbeiträge?
Die BKW unterstützt die Stossrichtung des Bundesrates, die Förderung der erneuerbaren Energien marktnäher und wettbewerblicher auszugestalten. Dazu eignet sich das vom Bundesrat vorgeschlagene Modell der Investitionsbeiträge. Solche sollten nach Ansicht der BKW generell ausgeschrieben werden (der Bundesrat sieht Ausschreibungen für grosse PV-Anlagen vor). Da Investitionsbeiträge weder eine feste Abnahme noch einen fixen Abnahmepreis garantieren, verbleiben bei den Investoren starke Anreize, ihre Anlagen effizient und nach den Bedürfnissen des Marktes zu betreiben. Vor allem aber bleiben die Investoren Unternehmer, da sie die Chancen und Risiken ihrer Investition selber tragen. Falls sie sich gegen sinkende Preise absichern möchten, bietet der Markt ihnen bereits heute Möglichkeiten. Vermehrt werden in Europa zu diesem Zweck sogenannte «Power Purchase Agreements» abgeschlossen, also langfristige Stromlieferverträge.
Bei einigen Akteuren der Energiebranche findet das Modell des Bundesrates dagegen wenig Anklang. Sie würden es begrüssen, wenn der Gesetzgeber das KEV-System zu einer «gleitende Marktprämie» weiterentwickelt. Weiterhin soll der Anlagenbetreiber über eine Zeitperiode von z.B. 25 Jahren eine feste Vergütung pro Kilowattstunde erhalten, die sich etwa an den durchschnittlichen Gestehungskosten orientiert (ggf. im Rahmen einer Auktion festgelegt). Im Gegensatz zur KEV wäre der Betreiber für die Vermarktung seines Stroms zuständig, wodurch er Erlöse am Markt erzielt. Der Staat zahlt die Differenz zwischen Marktpreis und der festgelegten Vergütung in Form einer Prämie – bei tiefen Preisen wäre diese hoch, respektive positiv, bei hohen Preisen dagegen tief oder gar negativ.
Marktrisiken: Beim Investor oder dem Konsumenten?
In einer «optimalen Welt» zahlt ein Fördermodell den Investoren genau jenen Betrag, der für die Erstellung und den Betrieb einer Produktionsanlage nötig ist, aber nicht durch Markterträge erwirtschaftet werden kann. Auch wenn jedes Fördermodell diesen Zweck verfolgt, so sind die Wirkungen in der Praxis unterschiedlich. Ein bedeutender Unterschied liegt in der Risikotragung. Aufgrund der festen Vergütung bei der KEV sowie der gleitenden Marktprämie stellen Marktpreisveränderungen für die Investoren weder ein Risiko noch eine Chance dar. Bei Investitionsbeiträgen hingegen tragen die Investoren sowohl Chancen als auch Risiken des Marktpreises: Der Investitionsbeitrag reduziert lediglich die Kosten der Anfangsinvestition, die künftigen Erträge werden vollständig am Markt generiert – und über die künftigen Marktpreise besteht keine Sicherheit. Nicht selten wird daher argumentiert, dass eine Förderung mittels KEV oder gleitender Marktprämie eine «günstigere» Form der Subventionierung darstelle, da die Investoren keine finanzielle Abgeltung für die Risikotragung in Form einer höheren Kapitalrendite benötigen würden. Dieses Argument ist indes falsch, zumal sich die Marktrisiken auch bei der KEV sowie der gleitenden Marktprämie nicht in Luft auflösen – vielmehr werden sie durch die Gesellschaft bzw. die Stromkonsumenten über den Netzzuschlag getragen.
Gerade weil das Risiko durch die Allgemeinheit getragen wird, lassen sich die Kosten für die Konsumenten nicht fest planen: Sinkt der Marktpreis, muss die Subvention aufgestockt werden. Aktuelles Beispiel dafür ist Deutschland, wo nach dem Preiseinbruch während der Corona-Krise ein Anstieg der EEG-Abgabe droht. Ironischerweise steigen nun die Stromkosten für die Verbraucher, obschon die Preise am Markt sinken. Bei den Investitionsbeiträgen dagegen existiert diese Unsicherheit über die gesellschaftlichen Kosten der Erneuerbaren-Förderung nicht, weil die Zahlungen einmalig erfolgen und keine langjährigen unsicheren Zahlungsverpflichtungen für die Allgemeinheit entstehen.
Marktnähere Produktion mit Investitionsbeiträgen
Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien ist eine effiziente Einbettung dieser Produktion in die Marktmechanismen nötig. Genau dies vermag die KEV nicht zu leisten. Nach dem Prinzip «produce and forget» maximieren Anlagenbetreiber ihre Produktion – vollkommen abgekoppelt von den Bedürfnissen des Marktes. Weil die Vergütung fix ist, lohnt sich selbst dann eine Produktion, wenn die Preise am Markt bereits ins Negative gefallen sind – was aufgrund des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien durchaus vorkommt (vgl. ElCom-Studie vom Juni 2020). Umgekehrt gibt es keine Anreize, mit der Anlage dann zu produzieren, wenn der Strom knapp ist und die Marktpreise eigentlich hoch wären.
Die Weiterentwicklung der KEV zu einer gleitenden Marktprämie kann diese Schwäche nur teilweise ausräumen. In Deutschland etwa wird die Marktprämie auf monatlicher Basis ausbezahlt. Dabei bestimmt ein Regulator die Prämie für sämtliche Anlagen anhand der Marktwertigkeit der Produktion einer generischen Anlage. Bei den einzelnen Anlagen, die ihren Strom selber vermarkten, verbleibt damit ein Anreiz, ihre Produktion stärker am Markt auszurichten, um über die Prämie hinaus Markterträge zu optimieren – beispielsweise würden sie während Stunden mit negativen Preisen keinen Strom produzieren.
Wird die Prämie monatlich oder gar wöchentlich bestimmt, resultiert jedoch nicht unbedingt ein Anreiz, die Anlage auch nach saisonalen Bedürfnissen auszurichten. Dies illustriert ein vereinfachendes Beispiel mit folgenden Annahmen: Im Sommer gäbe es bereits so viel PV, dass deren Marktwertigkeit null ist. Im Winter dagegen wären die Preise enorm hoch und übersteigen die PV-Gestehungskosten. Würde die PV Anlage so ausgerichtet, dass sie im Sommer kaum, aber im Winter umso mehr produziert, würden im Sommer aufgrund der ausfallenden Prämie keine Erträge resultieren, während die Erträge im Winter teilweise durch die negative Prämie gekürzt würden. Es wäre für den Anlagenbetreiber daher rational, auch im Sommer zu produzieren, um von den ausbezahlten Prämien zu profitieren – unabhängig von der fehlenden Nachfrage bzw. Marktwertigkeit im Sommer. Anders bei Investitionsbeiträgen: Nach Erhalt der einmaligen Subvention hat der Betreiber Anreize, seine Anlage vollständig an den Bedürfnissen des Marktes auszurichten.
Vielfalt von Fördermodellen in Europa
Häufig wird darauf verwiesen, dass die Marktprämie in Europa verbreitet sei und sich «bewährt» habe. Allerdings existiert in Europa eine Vielzahl von Fördermodellen, deren Abgrenzung voneinander nicht immer offensichtlich ist. Neben Marktprämienmodellen existieren Quoten- bzw. Zertifikatsmodelle (Schweden und Norwegen, wobei in Norwegen die Förderung 2021 ausläuft) sowie Investitionsbeiträge. So fördern etwa Finnland oder Österreich PV und Wasserkraft mittels einmaligen Investitionszuschüssen, in Schweden wird die PV neben dem Zertifikatsystem noch mit Investitionsbeiträgen gefördert. Aber auch bei der Ausgestaltung der Marktprämienmodelle gibt es Unterschiede.
- Fix: Marktprämien können auch fix ausgerichtet werden. In einem solchen Modell – das z.B. in Deutschland für (technologieneutrale) sog. Innovationsausschreibungen Anwendung findet – erhält der Betreiber einen festen Beitrag pro produzierter Kilowattstunde. Unter Berücksichtigung der Diskontierung konvergiert dieses Modell mit einem Investitionsbeitrag.
- Asymmetrisch: Daneben werden in Deutschland Marktprämien asymmetrisch ausbezahlt. Das heisst, die Prämie wird nie negativ. Anlagenbetreiber können sich damit gegen tiefe Preise absichern, behalten aber das Upside-Potenzial des Marktes. Das klingt im ersten Moment attraktiv. Doch kann dies dazu führen, dass bei den Auktionen aggressiver geboten wird, da Investoren an ein Upside glauben und gezielt Risiken eingehen – bei Wind-Offshore gab es tatsächlich Gebote bei null.
- Kurz: Ausserdem gibt es Länder, die zwar eine gleitende Marktprämie auszahlen, allerdings nur für relativ kurze Dauer. Das heisst, die Anlagen werden bereits nach 10 oder 12 Jahren dem Markt ausgesetzt. Im Extremfall konvergiert ein solches Prämienmodell mit einem Investitionsbeitrag: Würde die Prämie theoretisch nur während eines Jahres ausbezahlt, käme sie etwa einem Investitionsbeitrag gleich.
Und was passt für die Schweiz?
Die Vielfalt der Modelle illustriert, dass die Förderung der erneuerbaren Energien auf unterschiedliche Weise erfolgen kann. Die Erfahrungen zeigen, dass mit steigendem Erneuerbarem-Anteil eine effiziente Marktintegration immer wichtiger wird. Dies kann einerseits mit der Vergabe von Fördermitteln mittels Auktionen erfolgen. Diese können sowohl bei der Marktprämie als auch bei Investitionsbeiträgen Anwendung finden. Anderseits sollte die Auszahlung der Fördermittel möglichst starke Anreize für eine am Markt orientierte Produktion vermittelt – und das trifft bei Investitionsbeiträgen besonders zu. Sie tragen daher auch effektiver zur Versorgungssicherheit bei (siehe Textbox).
Im Schweizer Kontext ist ausserdem zu beachten, dass sich aufgrund der technischen Potenziale die Förderung wesentlich auf die PV konzentrieren wird sowie – in geringerem Ausmass – auf den Ausbau der Wasserkraft. Bei beiden Technologien hat die Schweiz bereits Erfahrungen mit Investitionsbeiträgen gemacht. Gerade bei der Wasserkraft dürften sich auch künftig eher Investitionsbeiträge eignen. Die Lebensdauer solcher Anlagen kann 60 oder 80 Jahre betragen. Entsprechend richtet sich auch deren Business Case an einer langfristigen Lebensdauer aus. Eine während 20 Jahren ausbezahlte Marktprämie schafft für solche Anlagen nur wenig Absicherung gegen Marktpreisrisiken, da ein Grossteil der Erträge nach Ablauf der Förderperiode anfallen würde. Entweder müsste die während der kurzen Periode ausbezahlte Marktprämie um ein vielfaches höher sein als bei anderen Technologien mit kürzerer Lebensdauer – dann aber würde die Marktprämie annäherungsweise zu einem Investitionsbeitrag (siehe oben). Oder die Marktprämie müsste über die nächsten 60 oder 80 Jahre ausbezahlt werden.
Es ist schwer vorstellbar, dass Politik und Gesellschaft derart langfristige Subventionsverpflichtungen eingehen würden. Schliesslich sollte Subventionierung kein Dauerzustand sein, sondern – wie auch im Rahmen der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 der Schweizer Stimmbevölkerung versprochen – lediglich eine Anschubfinanzierung während einer Übergangsphase.
Erneuerbaren-Förderung und die Förderung der Versorgungssicherheit – zwei Ziele, zwei Instrumente
Die Förderung der erneuerbaren Energien wird in europäischen Ländern von den Instrumenten der Versorgungssicherheit getrennt. Während für die Erneuerbaren-Finanzierung Marktprämien, Investitionsbeiträge oder Zertifikatslösungen eingesetzt werden, fördern sogenannte Kapazitätsmechanismen oder -märkte spezifisch Kraftwerke, die einen Beitrag zur Versorgungssicherheit während allfälligen Knappheitssituationen leisten können. Gerade weil die beiden Systeme separiert sind, lassen sich bei der Versorgungssicherheit auch fossil-thermische Kraftwerke fördern. Solche würden womöglich gar nicht produzieren, sondern lediglich als Back-up-Technologie im Sinne einer Versicherung für kritische Versorgungssituationen während weniger Tagen oder gar Stunden eingesetzt.
In den aktuellen Diskussionen um Versorgungssicherheit in der Schweiz wird die erneuerbaren Förderung häufig mit der Frage der Versorgungssicherheit vermischt. Vermehrt wird daher gefordert, dass die Erneuerbaren-Förderung parallel die Versorgungssicherheit adressieren sollte. Dabei wird häufig pauschal auf die Notwendigkeit von mehr Winterproduktion hingewiesen. Während Investitionsbeiträge generell Anreize schaffen, die Produktion am Markt und damit an den hohen Preisen (im Winter) auszurichten, bräuchte es im Rahmen einer Marktprämie eine zusätzliche Komponente, um diesen Anreize „künstlich“ zu schaffen. Denkbar wäre, dass die Auszahlungen (Prämien) in den Wintermonaten pauschal um 10% angehoben würden. Auch im Kontext einer allfälligen Auktion der Marktprämie würden dadurch Anlagen mit höherer Winterproduktion wettbewerblicher. Die besondere Herausforderung eines solchen Ansatzes ist offensichtlich: Der Aufschlag muss irgendwie und von jemandem festgelegt werden. Reichen 10% oder braucht es 30%? Der Zuschlag könnte administrativ auf Basis der Mehrkosten von winterstromproduktionsfähigen Technologien festgelegt werden – aber von welcher? In jedem Fall wäre die Festlegung in der Praxis schwierig. Auch würde das Instrument der Auktion (das Wettbewerb schaffen soll) aufgrund der Vermischung mit einer Kostenregulierung verwässert.
Sinnvollerweise werden die Förderung von Erneuerbaren und Versorgungssicherheit nicht miteinander vermischt. Zur Förderung der Versorgungssicherheit sollte ergänzend ein technologieneutrales Ausschreibungsmodell eingesetzt werden, das den Beitrag einer bestimmten Anlage zur Versorgungssicherheit in potenziell kritischen Versorgungssituationen (v. a. in den späteren Wintermonaten) berücksichtigt und entsprechend honoriert. Tatsächlich sieht auch der Bundesrat im Rahmen der StromVG-Revision separate Ausschreibungen für die Versorgungssicherheit vor, allerdings möchte er diese auf erneuerbare Energien beschränken. Die BKW ist der Ansicht, dass solche Ausschreibungen Gaskraftwerke als mögliche Back-up-Technologie nicht zum Vornherein ausschliessen sollten, da ihr Nutzen aufgrund ihrer hohen Verfügbarkeit und tiefen Investitionskosten auch ökonomisch bedeutend wäre. Auch hier eignen sich daher eher Investitionsbeiträge, da ein fossiles Back-up-Kraftwerk nicht nach seiner effektiven Produktion subventioniert werden kann – schliesslich soll es in der Regel gerade nicht produzieren.